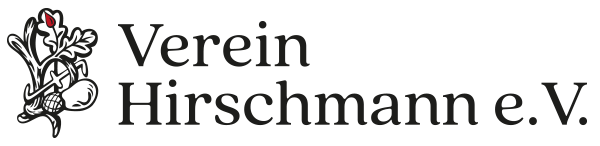2025
Heute stehen beim Verein Hirschmann annähernd 350 Hunde im täglichen Einsatz und verrichten dort jährlich rund 6.300 erschwerte Nachsuchen mit ca. 2.000 Hetzen (Stand 2024).
1958
170 eingetragene Hunde in das Zuchtbuch des Vereins Hirschmann.
1948
Wiederbegründung des Vereins Hirschmann
Nach Kriegsende fasste der Verein Hirschmann – im Gegensatz zu vielen anderen Jagdhundevereinen – in kürzester Zeit wieder Fuß, so dass man bereits am 17. März 1948 in Uslar im Solling zur Wiederbegründung schreiten konnte.
1944
150 Schweißhunde im Verein
Bis zum Zweiten Weltkrieg stieg der Bestand der Hunde auf 150 an. Der Weltkrieg bedeutete für das Zuchtgeschehen abermals einen herben Rückschlag. Viele Hunde gingen im Krieg verloren, durch die spätere Teilung Deutschland nahm der Bestand an Hannoverschen Schweißhunden drastisch ab.
1920
Kaum Hündinnen zur Zucht vorhanden.
Der Erste Weltkrieg (1914 – 1918) bedeutete eine tiefe Zäsur für die Zucht der Hannoverschen Schweißhunde. Viele Hunde gingen mit ihren Führern in den Kriegseinsatz und überlebten diesen nicht. Während des Ersten Weltkriegs wurden nur wenige Hunde, zumeist rückwirkend, in das Zuchtbuch eingetragen. Nach dem Krieg standen nur eine geringe Anzahl Hündinnen für eine weitere Zucht zur Verfügung. Die Hündin Isolde Hahnenklee (Zuchtbuchnummer 581), gewölft am 29. Juni 1921 und gezüchtet im Solling von Oberforstmeister Maximilian Gussone, gilt daher als eine der wenigen Ahnen der heutigen Hannoverschen Schweißhunde. 1923 war der Bestand an Schweißhunden wieder auf ca. 50 gestiegen.
1894
Gründung des Vereins Hirschmann
Die Gründungsversammlung des Vereins Hirschmann fand am 17. Juni 1894 in Silbers Hotel in Erfurt statt. Noch im gleichen Jahr wurde ein Zuchtregister anlegt und Rassekennzeichen wurden definiert. Der Rüde „Wille-Lonau“ ist die Nummer 1 im Zuchtbuch. Beschrieben wird er als hirschrot mit dunkler Maske, gewölft am 14. Januar 1893. Erfolgreich gezüchtet hatte Rittmeister Pitzschke, Eigentümer war Graf von Wintzingerode. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden sehr viele Hunde im Zuchtregister erfasst.
1885
Deutscher Schweißhund
Im Jahre 1885 erhielt der Schweißhund aus Hannover anlässlich einer Delegiertenversammlung des Vereins zur Veredelung der Hunderassen für Deutschland seinen Namen: „Hannoverscher Schweißhund“ / „Deutscher Schweißhund“.
1816 -1866
Durch Kreuzungen neu gezüchtet.
Nach dem Ende der napoleonischen Zeit in Europa wurde der Hannoversche Jägerlehrhof neu eingerichtet. Verbliebene Leithunde, Schweißhunde sowie Brackenkreuzungen mit Leit- und Schweißhundeblut wurden angekauft. Mit diesen drei fährtensicheren Rassen begann die Neuzüchtung, ab 1836 sogar im Stammbuch dokumentiert. Die Zuchtauswahl erfolgte weniger nach phänotypischen Merkmalen, sondern nach Leistung und Farbe. 1866 fiel Hannover an Preußen und die Auflösung des Jägerhofes war die Folge. Die Förderung des Schweißhundewesens wurde in der preußischen Forstverwaltung fortgeführt.
19. Jahrhundert
Hannoverscher Jägerlehrhof führt die Weiterentwicklung der Schweißhunde fort
Besonders der Hannoversche Jägerhof entwickelte im 19. Jahrhundert diese Hunderasse weiter. Der Hund wurde sowohl für das Bestätigen als auch zur Nachsuche auf krankgeschossenes Hochwild eingesetzt. Dabei wurde eine Führungsmethode geschaffen, die sich in einigen Abschnitten bis heute für den Nachsuchenhund bewährt hat, die sogenannte „Jägerhofmethode“. (link) Erklärung: Was ist das für eine Methode
Ende 18. Jahrhundert
Leithund trifft Heidbracke
Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen änderten sich die Jagdmethoden auf Hochwild von der Parforce-Jagd oder eingestellten Jagden zur Schießjagd. Man benötigte nun einen Hund zur Nachsuche auf angeschweißtes Wild. Der Leithund bot hierfür gute Voraussetzungen, seine Ruhe und sein ausgeprägter Fährtenwille prädestinierten ihn zum Einsatz auf der roten Fährte. Die herausgezüchtete Schärfe, Hetzfreude und Lautfreudigkeit wurde durch das Einkreuzen verschiedener Brackenarten, am bekanntesten die Heidbracke, wiedererweckt. Dicht an den Anforderungen des sich wandelnden Jagdbetriebs der damaligen Zeit orientiert, entwickelten sich so aus dem Leithund der höfischen Jagdgesellschaften verschiedene Schweißhunde-Mischungen.
800 -1750
Leithunde als genetische Vorfahren der Schweißhunde
Seit Karl dem Großen hat der Leithund eine außerordentliche Stellung bei der Jagd eingenommen und die Führungsmethode des Leithundes wurde ausgebaut. Man setzte den Leithund zum Ausarbeiten der Fährten starker Hirsche und Keiler ein. Berühmt waren die schwarzen Leithunde der Abtei St. Hubertus in den Ardennen. Diese Abtei züchtete über Jahrhunderte Spitzenhunde für den französischen Königshof. Die Führer von Leithunden waren die wichtigsten Jäger bei Hofe. Von ihnen und ihrem Können bei der Führung der Leithunde hing maßgeblich der Jagderfolg ab.
Keine Hochwildjagd ohne Leithund
Die Arbeit des Leithundes bestand in der Bestätigung des gesunden Hochwildes. Dies erfolgte durch die Vorsuche auf Wegen oder entlang von Feldlinien, wo das Wild ins Holz eingewechselt war. Zeigte der Leithund dann die gerechte Fährte, wurde diese auf Zuspruch bis zum Einstand gearbeitet. Der Jagdherr entschied dann über den weiteren Verlauf der Jagd. Oftmals kamen dann Lancierhunde zum Einsatz, die den Hirsch auf der warmen Fährte arbeiten und zum Verlassen der Dickung bewegen sollten. Das Stück konnte dann beim Verlassen der Dickung erlegt werden oder es wurde mit Hunden und zu Pferd Parforce zustande gehetzt und abgefangen. Der Hannoversche Schweißhund ist später fast unverändert aus dem alten Leithund weiter gezüchtet worden.
800 v. Chr. - 500 n. Chr.
Vom Segusierhund zum Leithund
Der Segusierhund hatte ähnlich spezialisierte Aufgaben wie der spätere Leithund bei den Parforce-Jagden des Mittelalters. Der Segusierhund wies durch seine kräftige Form große Ähnlichkeit mit dem Leithund auf. Der Unterschied des Leithundes zu den übrigen Bracken bestand im stumpfen Fang mit breiter Nase und dem starken Körperbau. Die Farbe war grau, schwarz und rot.
Keltenzeit
Weit zurück reicht die Entwicklungsgeschichte der Hannoverschen Schweißhunde: Ihre Spuren lassen sich bis in die Zeit der Kelten (ab etwa 800 v. Chr.) zurückverfolgen. Die Kelten benutzten zum Aufspüren des Wildes die Keltenbracke, auch Segusier genannt – nach dem gleichnamigen keltischen Volksstamm.